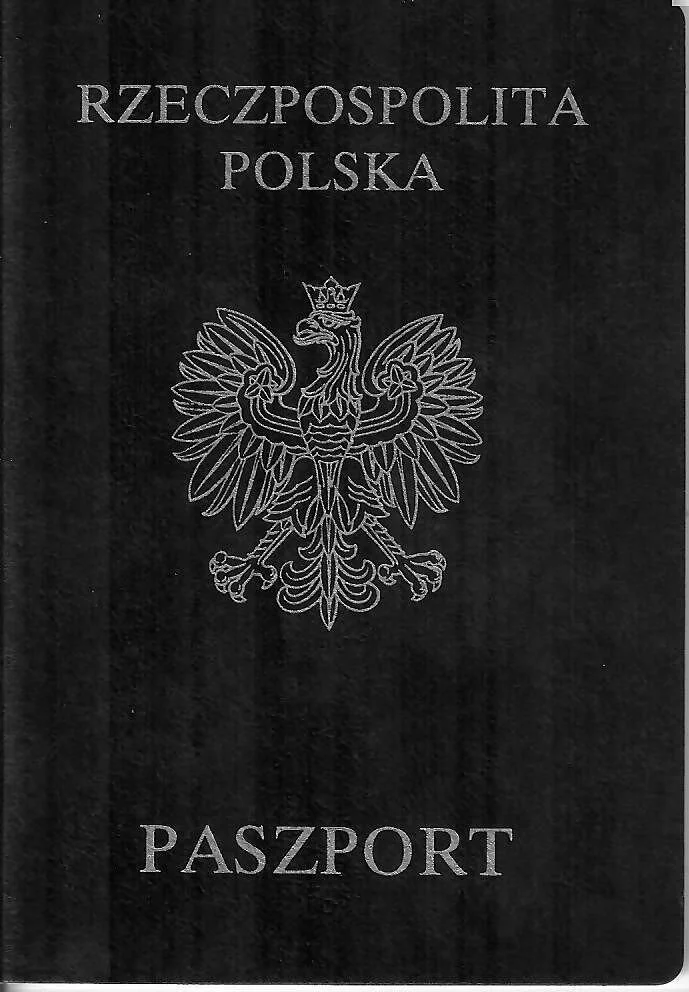Kunst und Gesellschaft – Ein Interview mit Natalie Sandsack
In ihrem Essay „Meine Augen sehen im Dunkeln“, entstanden in unserem Workshop Poetisches Foto-Essay, bearbeitet die Fotografin Natalie Sandsack sehr persönlich ihre Verstrickung zwischen Familie und Gesellschaft, Polen und Deutschland, gefühlter und zugeschriebener Identität. „Wer bin ich?“ ist die Frage, die sich durch ihr Essay zieht.
Die Antwort sucht sie in kreativen und emotionalen Selbstporträts, die die Serie strukturieren. Die aktuellen Fotos ergänzt sie mit Archivbildern ihrer Familie, Briefen und Ausweis-Dokumenten.
Ihr Essay zeigt, dass nicht nur private, sondern auch gesellschaftliche Themen poetisch und emotional fotografiert werden können, indem man sich ihnen künstlerisch nähert. Denn jedes gesellschaftliche Thema ist für viele Menschen gleichzeitig auch ein sehr persönliches.
Wir haben Natalie einige Fragen zu ihrem kreativen Prozess und dem Hintergrund ihres Essays gestellt:
Die Fotos stammen aus Natalies Foto-Essay „Meine Augen sehen im Dunkeln“
Erzählst du uns etwas über deinen kreativen Prozess?
Für das poetische Fotoessay habe ich mir im Vorfeld viele Gedanken zu meinem Thema gemacht, da ich schon wusste, in welche Richtung es gehen soll. Ich habe mich mit Freund*innen und meiner Familie ausgetauscht, viel in mein Handy geschrieben, zugehört und Podcasts gelauscht, Dokumentationen angeschaut. Ich habe Mindmaps zu bestimmten Themenfeldern erstellt, was ich wie darstellen möchte, welches Licht und welche Medien ich nutzen möchte.
Ich habe auch Inspiration bei anderen Künstler:innen gesucht und gefunden. Wenn ich mich auf zwei Fotograf:innen/Künstler:innen reduzieren müsste, dann würde die Arbeit folgender Künstlerinnen mein Fotoprojekt am besten zusammenfassen. Das autobiografische Fotoprojekt „Mother Land“ von Anya Tsaruk war dabei eine erste Annäherung an die Form und Aufarbeitung des Themas. Moshtari Hilal inspirierte mich durch ihre künstlerische Arbeit mit Selbstporträts, der Infragestellung gesellschaftlicher Normative und insbesondere in ihrer Anwendung von diversen Medien und Familienarchiven.
Der ganze Schaffensprozess fing somit schon viel früher – als mit dem Fotografieren an sich – an. Das Fotografieren geschah dann auf Grundlage meiner Vorarbeiten.
Im Moment des Fotografierens war der Weg wohl in erster Linie ein intuitiver, jedoch durch mein Wissen und meine gelebten Erfahrungen geleitet.
Es gab sicher auch Bilder, die als eine Art Vorlage dienten, deren Nachahmung mir aber immer als langweilige Kopie erschien. Ich habe angefangen, mich auf meine Geschichte zu konzentrieren und nicht eben auf das Ergebnis. Ich wollte weg vom Ergebnis, hin zu einem Prozess, der meine Fragen beantwortet. Ich wollte Bilder, die mein Gefühl übersetzen.
Ein zentrales Stilmittel deiner Serie sind Selbstporträts. Welche Rolle spielen Selbstporträts in der Darstellung deiner Identität für dich?
Selbstporträts sind ein essenzieller Bestandteil meiner fotografischen Arbeit. Mit dem Beginn meiner Mutterschaft fing ich an, das Erlebte durch meine Kamera festzuhalten. Nicht zuletzt, um sich zu erinnern, sondern vor allem auch, um das Erlebte zu verarbeiten.
Ich habe gemerkt, dass ich mit meinen Selbstporträts auch ein stückweit Frieden mit mir schließen will. Umso mehr Bilder ich von mir mache, mich anschaue und mich in spezifischen Situationen sehe, desto mehr fange ich an, das alles auch ok zu finden.
Selbstporträts sind für mich ein großer Schritt in Richtung Selbstakzeptanz.
Mein Körper, meine Gefühle, meine Verbindung zur Welt und auch das Erwachsenwerden. Mich dabei zu beobachten, wie und was ich fühle, um dann vielleicht das warum zu verstehen und zu akzeptieren. Selbstporträts sind mein Weg, um diesen ganzen Prozess wenigstens bruchstückhaft zu verstehen. Zu verstehen, was eigentlich in diesem Leben alles passiert ist. Mit mir, mit meiner Familie, mit uns. Dabei helfen mir Bilder meist auch erst rückblickend zu verstehen, was damals in mir vorging. Was ich gefühlt habe, was wertvoll für mich war, wovor ich vielleicht Angst hatte, was mich traurig gemacht hat, als ich den Auslöser drückte.
Gab es Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die Vielschichtigkeit deines Themas visuell umzusetzen?
Definitiv gab es Schwierigkeiten, die Vielschichtigkeit von Themen wie Identität, Herkunft, Emotionen und gelebter Erfahrung visuell darzustellen, nicht zuletzt vor allem beruhend darauf, mich und die eigene Verletzlichkeit in den Fokus der eigenen Arbeit zu stellen und sich damit auch existenziell angreifbar zu machen.
Zum anderen ist es nicht nur meine Geschichte, die ich in diesem Essay erzähle. Hier behutsam mit den Gefühlen meiner Familie, dem Aufreißen alter und neuer Wunden umzugehen, erforderte Feingefühl und tatsächlich auch Loslassen möglicher Ideen, die für andere Beteiligte zu schwer wogen.
Bis heute kommen diese Unsicherheiten auf. Deshalb war und bin ich so dankbar für den engen Austausch und die Reflexion, die ihr – als Gruppe und Mentorinnen – ermöglicht habt, denn Emotionen und persönliche Erfahrungen sind oft so abstrakt und schwer in konkrete Bilder umzusetzen. Um sich nicht zu verlieren, zu verzweifeln oder sogar ganz abzubrechen – auch auf einer ganz praktischen Ebene – war die Kursbegleitung für mich so krass wichtig und bereichernd.
Hat sich dein Blick auf einzelne Fotos als Teil einer Serie mit dem Workshop Poetisches Foto-Essay verändert?
Der Workshop hat meinen Blick auf einzelne Fotos innerhalb einer Serie um 100% verändert. Ich möchte jetzt nur noch in Serien denken. Nicht nur für mein persönliches Archiv, sondern auch für meine Kundinnen. Ich bin dokumentarische Familien- und Porträtfotografin und erzähle per se Geschichten. Das Fokussieren auf die Erzählung und eine kohärente Verbindung zwischen Bildern, um eine Familiennarration festzuhalten, die über Generationen weitergegeben wird, das ist immer mein größter Anspruch.
Dabei hing mein Blick bei der Bildauswahl immer an der Chronologie der Geschichte und eben nicht in visuellen Formen, in einer bestimmten Ästhetik und narrativen Kohärenz.
Die Betrachtung der Bildabfolge, des Rhythmus, der Formen und Kontraste sowie der erzählerischen Entwicklung innerhalb einer Serie möchte ich nun viel stärker in meine Herangehensweise an Fotoprojekte integrieren.
Diese neue Sichtweise eröffnet mir einen komplett neuen Zugang zu meinen Bildern. Ich habe das Gefühl, ich entdecke sie gerade alle neu.
War es hilfreich, deine Fotos zum Sequenzieren auszudrucken?
Das Ausdrucken meiner Fotos war definitiv hilfreich und sowas von überfällig. Das physische Handling der Bilder ermöglichte mir eine ganz andere Herangehensweise als das Betrachten auf einem Bildschirm. Ich habe für mich einen neuen Aspekt dazugewonnen. Die Auseinandersetzung mit dem Bild an sich. Es ist der Moment, in dem ich mich zum ersten Mal mit dem Bild an sich „verbunden“ habe. Ich würde es vielleicht so beschreiben:
Das Fotografieren ist die Verbindung mit der Welt, eine Verhandlung zwischen einer Realität und mir selbst.
Aber das Editieren und BE-GREIFEN der Bilder, ist die Auseinandersetzung ganz mit mir selbst (In Anlehnung an Cristina de Middel). Das physische Berühren und Anordnen der gedruckten Fotos ermöglicht eine taktile Erfahrung, die das Verständnis der Beziehung zwischen den Bildern verbessert hat. Es war so viel einfacher, die Reihenfolge anzupassen und zu experimentieren, um die beste visuelle Erzählung zu finden. Das war eine ganz neue Erfahrung und dafür bin ich sehr dankbar.
Workshop Poetisches Foto-Essay
Verwandle deine Ideen und Gefühle in poetische Bilder und Geschichten. In diesem Workshop lernst du, eine visuelle Geschichte zu erzählen und findest deine ganz eigene Bildsprache. Du realisierst ein persönliches künstlerisches Projekt, lernst Kreativ-Techniken und gestaltest dein eigenes Buch.
Online-Workshop mit Gruppen-Mentoring und individuellem Feedback
Leitung: Eva Radünzel, Sonja Stich und Sonia Epple